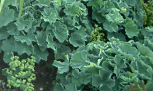Hörgerät wirksamer Schutz vor Demenz
Altersschwerhörigkeit führt dazu, dass Betroffene weniger äußere Stimuli wahrnehmen als Senioren mit guter Hörfähigkeit. Daher überrascht es nicht, dass ein Hörverlust im Alter in Untersuchungen mit einem erhöhten Demenzrisiko in Zusammenhang gebracht wurde. Wie stark sich dieser Risikofaktor auswirkt und ob ein Hörgerät vor Schwerhörigkeits-assoziierter Demenz schützt, hat nun ein Team um Dr. Fan Jiang von der Shandong University in Jinan, China, anhand von Daten aus Großbritannien untersucht. Das Ergebnis ist im Fachjournal »The Lancet Public Health« erschienen (DOI: 10.1016/S2468-2667(23)00048-8).
Die Gruppe wertete die Daten von 437.704 Personen aus, die in der UK Biobank registriert waren. Angaben zu Schwerhörigkeit und dem Gebrauch von Hörhilfen wurden bei Studienbeginn per Selbstauskunft eingeholt, Demenzdiagnosen aus Krankenhausakten und Todesregistern extrahiert. Die Teilnehmer waren zu Studienbeginn im Schnitt 56 Jahre alt und wurden durchschnittlich zwölf Jahre lang nachbeobachtet. Höreinschränkungen lagen bei rund einem Viertel der Teilnehmer vor und von diesen schwerhörigen Probanden nutzten 11,7 Prozent (13.092 von 111.822) ein Hörgerät.
Die Auswertung zeigte einen klaren Zusammenhang zwischen Schwerhörigkeit und Demenz: Teilnehmer, deren Höreinschränkung nicht durch ein Hörgerät korrigiert war, hatten ein 42 Prozent höheres Demenzrisiko als Probanden, die nicht schwerhörig waren oder die schwerhörig waren und ein Hörgerät benutzten. Das absolute Risiko, eine Demenz zu entwickeln, betrug in der Gruppe der Schwerhörigen ohne Hörhilfe 1,7 Prozent. Unter denjenigen, die gut hörten (entweder von Natur aus oder dank Hörgerät), lag das absolute Demenzrisiko dagegen bei 1,2 Prozent.
Da Altersschwerhörigkeit oft auch mit sozialer Isolation, Einsamkeit und depressiven Symptomen einhergeht, bezogen die Autoren diese Faktoren in ihre Berechnung mit ein. Sie kommen zu dem Schluss, dass weniger als 8 Prozent des beobachteten Effekts von Hörgeräten auf die Vermeidung solcher psychosozialen Probleme zurückzuführen sind. Der durch eine Hörhilfe vermittelte Schutz vor einer Demenzerkrankung sei also überwiegend eine direkte Folge des besseren Hörens und nur nachgeordnet ein indirekter Effekt, lautet ihre Schlussfolgerung.
»Es gibt eine wachsende Evidenz dafür, dass ein Hörverlust im mittleren Alter unter den modifizierbaren Risikofaktoren für Demenz derjenige ist, der sich am besten beeinflussen lässt«, kommentiert Seniorautor Professor Dr. Dongshan Zhu in einer begleitenden Pressemitteilung. Die Studie habe gezeigt, dass Hörhilfen eine kosteneffektive Möglichkeit darstellen, um dieses Risiko zu senken. Viel zu oft tragen jedoch ältere Menschen kein Hörgerät, obwohl sie es eigentlich bräuchten.
»Ein Nachlassen der Hörfähigkeit setzt oft schon mit Anfang 40 ein und der fortschreitende kognitive Abbau, der einer Demenzdiagnose vorausgeht, kann 20 bis 25 Jahre dauern. Unsere Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen mit beginnender Schwerhörigkeit frühzeitig mit einem Hörgerät versorgt werden«, betont Zhu. In den USA gebe es bereits Hörgeräte als OTC, was die Verfügbarkeit dieser wichtigen Hilfsmittel steigere, ergänzen Professor Dr. Gill Livingston und Dr. Sergi Costafreda vom University College London in einem begleitenden Kommentar.
Die andere Pille danach
Auch hierzulande steigen die Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten wie Syphilis, Tripper und Chlamydien an. Eine Studie zeigt, dass eine Postexpositionsprophylaxe mit Doxycyclin, die sogenannte DoxyPEP, eine wirksame Maßnahme zur Prävention nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr darstellen könnte.
Im »New England Journal of Medicine« hat ein Team um Dr. Annie Luetkemeyer von der University of California in San Francisco Daten zum Einsatz der DoxyPEP aus einer randomisierten Studie veröffentlicht (DOI: 10.1056/NEJMoa2211934). Rund 500 Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), und Transfrauen wurden in die Studie aufgenommen. Alle nahmen eine HIV-Präexpositionsprophylaxe (HIV-PrEP) ein oder lebten mit einer HIV-Infektion. Zudem war bei allen im Jahr vor Studienstart eine Infektion mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (STI) diagnostiziert worden.
Einnahme bei Bedarf
Die Verumgruppe sollte innerhalb von 72 Stunden nach kondomlosem Geschlechtsverkehr einmal 200 mg Doxycyclin einnehmen, die andere Gruppe nicht. Diese »Pille« (genauer gesagt waren es Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung) wurde in der Verumgruppe durchschnittlich vier Mal pro Monat verwendet, wobei 25 Prozent zehn Dosen oder mehr einnahmen. Primärer Endpunkt der Studie war die Inzidenz von mindestens einer STI pro Nachbeobachtungsquartal. Tests auf Gonorrhö (Tripper), Chlamydien und Syphilis wurden vierteljährlich dazu durchgeführt.
Das Ergebnis: In der PrEP-Kohorte wurde bei 61 von 570 vierteljährlichen Besuchen (10,7 Prozent) in der Doxycyclin-Gruppe und 82 von 257 vierteljährlichen Besuchen (31,9 Prozent) in der anderen Gruppe eine STI diagnostiziert. In der Kohorte mit Menschen mit HIV wurde eine STI bei 36 von 305 vierteljährlichen Besuchen in der Doxycyclin-Gruppe (11,8 Prozent) und 39 von 128 vierteljährlichen Besuchen (30,5 Prozent) in der Vergleichsgruppe diagnostiziert.
Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Inzidenz von Tripper, Chlamydien und Syphilis insgesamt bei einer Doxycyclin-Postexpositionsprophylaxe um zwei Drittel im Vergleich zur anderen Gruppe reduziert worden war. Besondere Bedenken hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils, der Sicherheit oder der Akzeptanz formulieren sie nicht. Das sagen Experten aus Deutschland
Das Science Media Center hat Expertenstimmen eingeholt, um dieses Studienergebnis einzuordnen. Privatdozent Dr. Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München sagt zum Beispiel: »Die Verwendung einer Einmaldosis von 200 mg Doxycyclin nach kondomlosem Verkehr als Postexpositionsprophylaxe reduziert in der vorgestellten Studie wirksam und klinisch relevant die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen, sexuell übertragbaren Infektion. Hierbei sind sowohl Chlamydien-, Syphilis- als auch Gonokokken-Infektionen signifikant seltener berichtet worden. Die prospektive Studie ist methodisch gut konzipiert. Bakterielle sexuell übertragbare Infektionen verursachen weltweit weiter eine erhebliche gesundheitliche Belastung für Gesundheitssysteme und einzelne Patientinnen und Patienten.«
Der Mediziner erinnert aber auch daran, dass der unkritische Einsatz von antimikrobellen Substanzen für Resistenzen und Problemkeime mitverantwortlich ist. Für die Übertragung der klinischen Studienergebnisse in den medizinischen Alltag brauche es daher dringend entsprechende Leitlinien und Empfehlungen, insbesondere auch in welchen Konstellationen und Zielgruppen der Einsatz denkbar sein könnte. Für Professor Dr. Norbert Brockmeyer von der Ruhr-Universität Bochum, Vorsitzender der Deutschen-STI-Gesellschaft, sind die Daten aus den USA nicht eins zu eins auf Europa übertragbar. Er betont, dass die Resistenzraten für Gonokokken in den USA bezüglich Doxycyclin mit etwa 25 Prozent deutlich geringer seien als in Europa mit etwa 60 bis 70 Prozent und in Deutschland mit nahezu 80 Prozent. Man könne in der EU demnach nur mit einer Verringerung der Infektionen bei Chlamydien und Syphilis rechnen. Brockmeyer bringt in seinem Statement auch die Impfung mit einem Meningokokken-B-Impfstoff für Risikopersonen für eine Gonokokken-Infektion ins Spiel.
Gürtelroseimpfung senkt Alzheimerrisiko
Dass eine virale Infektion viele über eine akute Erkrankung hinausgehende Komplikationen verursachen kann, weiß man nicht erst seit dem Auftauchen von SARS-CoV-2. Jetzt legt eine aktuelle Studie nahe, dass ein Herpesvirus an der Entwicklung von Alzheimer beteiligt sein könnte.
Es ist gut belegt, dass virale Infektionen Spätfolgen nach sich ziehen können, die sich aus der Symptomatik der akuten Infektion nicht offensichtlich ableiten lassen. Aktuell bereiten Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion große Sorgen. Und seit Kurzen verdichten sich auch Hinweise darauf, dass das Epstein-Barr-Virus an der Genese einer Multiplen Sklerose beteiligt sein könnte.
Dass eine Alzheimer-Demenz von einer viralen Infektion getriggert wird, ist bisher nicht gut belegt. Allerdings mehren sich Hinweise, dass Herpesviren bei der Entstehung von Demenz eine Rolle spielen könnten. So wurde beobachtet, dass Herpesviren in Mäusen die Bildung von β-Amyloid induzieren können. Außerdem finanziert das US National Institute on Aging eine Phase-II-Studie, in der die Wirkung eines antiviralen Medikaments auf die kognitiven und funktionellen Fähigkeiten von Patienten mit leichter Alzheimer-Demenz getestet wird. Ein zu einer antiviralen Therapie alternativer Ansatz bestünde darin, zur Risikoreduktion einer Alzheimer-Erkrankung gegen eine Herpesinfektion zu impfen.
Dass genau diese Strategie erfolgreich sein könnte, deuten nun Arbeiten eines internationalen Forscherteams an, an dem auch Forschende aus Heidelberg und Mainz mitwirkten. Die Ergebnisse ihrer Forschung legen nahe, dass das Varizella-zoster-Virus, der Erreger der Windpocken und der Gürtelrose (Herpes zoster), an der Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beteiligt sein könnte. Die Publikation, in der die Forschungsergebnisse beschrieben werden, ist auf dem »Medrxiv« Preprint-Server zugänglich und wurde daher noch nicht begutachtet.
Natürliche Randomisierung durch Impfstrategie zum Schutz vor Herpes zoster in Wales
Die Forschenden nutzen für ihre Analyse den Umstand, dass in Wales ab dem 1. September 2013 nur diejenigen Anspruch auf eine Impfung mit dem Herpes-zoster-Lebendimpfstoff Zostavax® zur Vorbeugung gegen Gürtelrose hatten, die am oder nach dem 2. September 1933 geboren wurden. Wer vor dem 2. September 1933 geboren wurde, hatte keinen Anspruch auf eine Impfung und blieb lebenslang von dieser Vorsorgemaßnahme ausgeschlossen. Diese Anordnung galt ungeachtet der Tatsache, dass der Impfstoff für Personen ab einem Alter von 50 Jahren zugelassen ist.
Anhand von landesweiten Daten über alle erhaltenen Impfungen, über die primäre und sekundäre Gesundheitsversorgung, über Sterbeurkunden und über das Geburtsdatum der Patienten in Wochen zeigen die Forschenden zunächst, dass die nationalen Vorgaben erstaunlich konsequent umgesetzt wurden. Denn nur 0,01 Prozent der Erwachsenen, die nur eine Woche zu alt waren, um für die Impfung zu qualifizieren, hatten eine Impfung erhalten. Dagegen stieg der Prozentsatz der Geimpften auf 47,2 Prozent bei denjenigen an, die nur eine Woche jünger waren.
Tatsächlich gibt es keinen anderen plausiblen Grund, warum sich diejenigen, die nur eine Woche vor dem 2. September 1933 geboren wurden, systematisch von denen unterscheiden sollten, die eine Woche später geboren wurden. Dies weisen die Forschenden empirisch nach, indem sie zeigen, dass es ansonsten keine systematischen Unterschiede beispielsweise in Bezug auf Vorerkrankungen oder auf die Inanspruchnahme anderer präventiver Maßnahmen zwischen den vor beziehungsweise nach dem 2. September 1933 geborenen Erwachsenen gibt.
Somit resultiert aus den Vorgaben zur Herpes-zoster-Impfung in Wales eine einzigartige natürliche Randomisierung, die es erlaubt, eine robuste Schätzung kausaler Effekte und nicht etwa Korrelationseffekte zu ermitteln.
Hier zeigen die Forschenden, dass die Impfung zum Schutz vor Herpes zoster mit Zostavax nicht nur vor einer Gürtelrose schützt, sondern dass die Impfung auch die Wahrscheinlichkeit einer neuen Demenzdiagnose über einen Nachbeobachtungszeitraum von sieben Jahren um 3,5 Prozentpunkte verringert. Dies entspricht einer relativen Verringerung des Auftretens einer Demenz um 19,9 Prozent.
Impfung reduziert nur die Risiken für eine Gürtelrose und für eine Demenz
Neben der Vorbeugung vor Gürtelrose und Demenz identifizierten die Forschenden keine Auswirkungen auf andere häufige Ursachen von Morbidität und Mortalität durch den Herpes-zoster-Impfstoff.
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Ergebnisse hinsichtlich der Risikoreduktion für eine Demenzerkrankung nicht durch unerkannte Störfaktoren bedingt sind. Zudem gibt es keine Hinweise darauf, dass diejenigen, die gegen Herpes zoster geimpft wurden, auch anderer Impfungen oder präventive Gesundheitsmaßnahmen stärker in Anspruch genommen haben als die Menschen in der Kontrollgruppe.
Und schließlich zeigen die Daten dieser Studie, dass die schützende Wirkung des Impfstoffs bei Frauen weitaus stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei Männern. Bei den Männern lagen die Punktschätzungen in allen Spezifikationen nahe bei Null. Dennoch schloss das 95 Prozent-Konfidenzintervall für den Effekt bei Männern die Möglichkeit eines relativen Schutzeffekts auf Demenz über einen Nachbeobachtungszeitraum von sieben Jahren von bis zu 23,9 Prozent ein. Bei Frauen hingegen war der schützende Effekt des Impfstoffs für Alzheimer-Demenz (p=0,018) signifikant stärker ausgeprägt als bei Männern. Für eine vaskuläre Demenz (p=0,376) und Demenz unspezifizierter Art (p=0,358) waren die geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht signifikant.
Wichtig zu erwähnen ist, dass sich diese Befunde nur auf den abgeschwächten Herpes-zoster-Lebendimpfstoff Zostavax beziehen. Der neuere rekombinante Untereinheit-Impfstoff Shingrix® war in Großbritannien erst nach dem Ende des Beobachtungszeitraums der Studie verfügbar.
Steckbrief : Liraglutid als Mittel gegen Übergewicht
Der GLP-1-Agonist Liraglutid kam zunächst als Antidiabetikum auf den Markt. Mittlerweile ist er auch als Mittel gegen Adipositas zugelassen – und es ist ein regelrechter Hype um die sogenannte Fettweg-Spritze entstanden.
Wirkweise: Liraglutid ist ein Analogon des Inkretin-Hormons Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) und wird daher auch als Inkretinmimetikum bezeichnet. Wie GLP-1 stimuliert Liraglutid glucoseabhängig die Insulinsekretion, senkt die Glucagonsekretion, verlangsamt die Magenentleerung und reduziert den Appetit. Es kann also den Blutzucker senken und dabei helfen, das Gewicht zu reduzieren. Durch chemische Modifikationen ist es länger wirksam als das natürliche GLP-1.
Einsatzgebiete: Seit 2009 ist Liraglutid in Deutschland als Victoza® verfügbar zur Behandlung eines unzureichend kontrollierten Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen und Kindern ab zehn Jahren zusätzlich zu Diät und körperlicher Aktivität. Es kann mit anderen Antidiabetika kombiniert werden oder als Monotherapie eingesetzt werden, wenn Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit oder Kontraindikation ungeeignet ist. Als Antidiabetikum ist Liraglutid verordnungsfähig zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Seit 2016 steht Liraglutid darüber hinaus als Saxenda® als Antiadiposium für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren ergänzend zu einer kalorienreduzierten Ernährung und mehr körperlicher Aktivität zur Verfügung. Der Ausgangs-BMI muss entweder mindestens 30 kg/m2 betragen oder zwischen 27 und 30 kg/m2, wenn mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung vorliegt. Zum Abnehmen ist Liraglutid bislang nicht verordnungsfähig zulasten der GKV.
Gegenanzeigen: Liraglutid darf Diabetes-Patienten nicht als Ersatz für Insulin verordnet werden. Bei Typ-1-Diabetes soll es nicht eingesetzt werden. Nicht empfohlen wird die Anwendung bei Herzinsuffizienz NYHA-Stadium IV und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Vorsicht ist angebracht bei leichter bis mittelschwerer Einschränkung der Leberfunktion sowie Schilddrüsenerkrankungen.
Da Sicherheit und Wirksamkeit zur Gewichtsreduktion bei folgenden Gruppen nicht erwiesen sind, wird die Anwendung von Saxenda hier nicht empfohlen: Alter ab 75 Jahren oder unter zwölf Jahren, bei gleichzeitiger Anwendung von anderen Produkten zur Gewichtsreduktion oder von Arzneimitteln, die zu einer Gewichtszunahme führen können, bei Adipositas als Folge einer endokrinen Störung oder Essstörung sowie bei schwerer Einschränkung der Nieren- oder Leberfunktion.
Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen nur begrenzte Daten vor, daher darf Liraglutid nicht während der Schwangerschaft und soll nicht während der Stillzeit eingesetzt werden.
Dosierung: Gestartet wird in beiden Indikationen mit 0,6 ml Liraglutid einmal täglich. Zur Gewichtsreduktion wird innerhalb von fünf Wochen bis auf eine Erhaltungsdosis von 3,0 mg einmal täglich hochdosiert. Bei Diabetes beträgt die Erhaltungsdosis nur maximal 1,8 mg täglich. Für Saxenda gilt: Hat der Patient nach zwölf Wochen Behandlung mit der Erhaltungsdosis nicht mindestens 5 Prozent des ursprünglichen Körpergewichts verloren, soll das Arzneimittel wieder abgesetzt werden, weil der Patient offensichtlich nicht darauf anspricht.
Unabhängig von der Indikation wird Liraglutid einmal täglich subkutan per Fertigpen in Bauch, Oberschenkel oder Oberarm gespritzt. Die Applikation kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen, aber jeden Tag möglichst etwa zur gleichen Zeit.
Nebenwirkungen: Sehr häufig kommt es zu Kopfschmerzen und gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung. Schwindel, Mundtrockenheit, Geschmacksstörungen, Blähungen und Sodbrennen sind häufig, ebenso Schlafstörungen in den ersten drei Monaten.
Besonders gewarnt wird in Produkt- und Fachinformationen vor Hypoglykämien, akuter Pankreatitis, Gallensteinen und Gallenentzündung, Dehydratation und in der Folge Beeinträchtigung der Nierenfunktion und akutem Nierenversagen. Da Liraglutid die Herzfrequenz erhöhen kann, sollte diese regelmäßig ärztlich überprüft werden.
Wechselwirkungen: Bei Diabetes-Patienten, die mit Insulin beziehungsweise Sulfonylharnstoffen behandelt werden, sollte der Arzt beim Start einer Liraglutid-Behandlung eine Dosisreduktion dieser Wirkstoffe erwägen, um das Risiko für eine Hypoglykämie zu senken. Der Patient soll regelmäßig selbst den Blutzucker kontrollieren, um die Insulindosis anzupassen.
Weitere GLP-1-Analoga: Der erste GLP-1-Agonist auf dem deutschen Markt war 2007 Exenatid (Byetta™), Liraglutid folgte 2009 und seitdem noch Lixisenatid, Dulaglutid und Semaglutid. Die entsprechenden Präparate unterscheiden sich teilweise in ihrer Wirkdauer, in den zugelassenen Indikationen und in der Darreichungsform. So muss Exenatid als Byetta™ zweimal täglich gespritzt werden, als Bydureon® ebenso wie Dulaglutid (Trulicity®) und Semaglutid (Ozempic®) nur einmal wöchentlich. Lixisenatid steht als Suliqua® als Fixkombination mit Insulin glargin für die einmal tägliche Anwendung zur Verfügung. Semaglutid ist als Rybelsus® z
udem in Tablettenform zugelassen (Einnahme einmal täglich). Alle genannten Präparate werden bei Typ-2-Diabetes eingesetzt. Darüber hinaus besitzt Semaglutid als Wegovy™ auch eine Zulassung als Antiadipositum; dieses Präparat wird einmal wöchentlich gespritzt. Weder Rybelsus noch Wegovy wurden allerdings vom Hersteller Novo Nordisk bislang in Europa auf den Markt gebracht.
Der Hype um die Wirkstoffklasse: Nach Berichten über zum Teil erhebliche Gewichtsverluste unter Anwendung von GLP-1-Analoga ist die Nachfrage nach den Wirkstoffen stark gestiegen. Das hat Folgen: Saxenda ist zurzeit nicht lieferbar und auch Ozempic wird voraussichtlich für das gesamte Jahr 2023 nicht zu bekommen sein, obwohl dieses Präparat ja eigentlich nur zur Behandlung von Typ-2-Diabetikern zugelassen ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die als Antidiabetika zugelassenen GLP-1-Analoga häufig off Label zum Abnehmen eingesetzt werden.
Sollte die Lieferfähigkeit der Präparate deren Auswahl irgendwann nicht mehr einschränken, könnte sich abzeichnen, dass Semaglutid als Antiadipositum besser wirksam ist als Liraglutid. Das zeigte jedenfalls die STEP-8-Studie, deren Ergebnisse 2022 im Fachjournal »JAMA« erschienen (DOI: 10.1001/jama.2021.23619). Die Teilnehmenden nahmen darin innerhalb von 68 Wochen mit Semaglutid durchschnittlich 15,8 Prozent ihres Ausgangs-Körpergewichts von 104 kg ab, mit Liraglutid 6,4 Prozent.
Bei körperlicher Bewegung und warmen Außentemperaturen ist der Wasserumsatz erhöht. Wie viele Liter müssen Menschen pro Tag trinken?
Pauschale Empfehlungen wie die häufig genannten zwei Liter sind nicht hilfreich, denn die benötigte Trinkmenge ist sehr individuell, zeigt eine »Science«-Publikation.
Durch Schweiß, Urin, Stuhl und Atmung verliert der Mensch jeden Tag Wasser und muss dieses wieder ersetzen. Als Water Turnover (Wasserumsatz) wird dieser tägliche Verbrauch bezeichnet. Wie viel Wasser ist aber nötig, sollte also getrunken werden, um die Verluste auszugleichen?
Viele Menschen haben im Hinterkopf die häufig genannten zwei Liter pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt differenzierte Empfehlungen und staffelt diese nach Alter – sie reichen von 400 ml täglich für Säuglinge bis zu 1700 ml täglich für Stillende. Die DGE rechnet auch vor, wie viel Wasser der Körper in etwa pro Tag umsetzt: Über den Urin gehen demnach 1440 ml verloren, über den Stuhl 160 ml, über die Lunge 500 ml und über die Haut 550 ml. Das sind insgesamt 2650 ml am Tag. Doch solche pauschalen Aussagen sind natürlich schwierig.
Ein internationales Forschungsteam um Yosuke Yamada vom japanischen nationalen Institut für Gesundheit und Ernährung in Tokio wollte es genau wissen und analysierte den Wasserumsatz und das Gesamtkörperwasser von 5604 Personen im Alter von 8 Tagen bis 96 Jahren aus 26 Ländern weltweit. Die Ergebnisse wurden Ende 2022 im Fachjournal »Science« veröffentlicht (DOI: 10.1126/science.abm8668).
Trinkbedarf abhängig von mehreren Faktoren
Die Forschenden ließen die Probanden eine kleine Menge Wasser trinken, die das Wasserstoff-Isotop Deuterium enthielt. Über die Geschwindigkeit, mit der das Isotop eliminiert wurde, ermittelten sie den Wasserumsatz und das Gesamtkörperwasser. Das Ergebnis: Der Wasserumsatz hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, nämlich Körpergröße und -zusammensetzung, Klima, Schwangerschaft und Energieverbrauch, also Aktivitätsgrad.
Den höchsten Wasserumsatz hatten in der Studie 20 bis 30 Jahre alte Männer und 20- bis 55-jährige Frauen. Das Gesamtkörperwasser war im Alter von 20 bis 40 Jahren bei beiden Geschlechtern am höchsten. Im Verhältnis zum Gesamtkörperwasser hatten Neugeborene den höchsten Wasserumsatz, der Wert sank dann mit zunehmendem Alter ab.
Einen starken Einfluss auf den Wasserumsatz hatte der Lebensstil. So hatten Personen aus Jäger- und Sammler-Gemeinschaften und Ackerbautreibende einen höheren Wasserumsatz als Menschen aus Industrienationen. Sportler hatten höhere Werte als Nichtsportler.
Von den 1875 untersuchten Männern hatten neun einen Wasserumsatz von mehr als 10 Litern am Tag. Von diesen waren vier Leistungssportler, vier gehörten zur ecuadorianischen Volksgruppe der Shuar, die Ackerbau und Jagd betreibt, und einer war ein normalgewichtiger Kaukasier, der bei einer Außentemperatur von fast 32 °C untersucht wurde. Bei den Frauen hatten 13 Werte von mehr als 7 Litern am Tag. Von ihnen waren fünf Athletinnen, zwei stark adipöse Schwangere, drei Adipöse, die nicht schwanger waren, und drei wurden im Sommer gemessen. Frauen in der Schwangerschaft hatten generell einen durchschnittlich höheren Wasserumsatz als Frauen außerhalb der Schwangerschaft. Im dritten Trimester war der Wasserumsatz um durchschnittlich 670 ml erhöht, in der Stillzeit um 260 ml im Vergleich zum Zeitraum vor der Schwangerschaft.
Wasseranteil der Nahrung mit berücksichtigen
Die Studie zeigt, dass eine allgemeine Trinkempfehlung nicht auf alle Menschen passt und der Wasserumsatz stark individuell sei, folgern die Forschenden um Yamada. Die häufig gehörte Empfehlung von zwei Litern am Tag sei wissenschaftlich nicht belegt. Häufig werde auch der Anteil der Wasseraufnahme über die Nahrung nicht berücksichtigt, heißt es in der Publikation. Dieser liege Schätzungen zufolge bei 20 bis 50 Prozent der täglichen Wasseraufnahme, sei aber bislang nicht wissenschaftlich exakt bestimmt worden. Die Empfehlung, zwei Liter täglich zu trinken, sei für die meisten Menschen häufig zu viel, sagte Koautor Professor Dr. John Speakman von der University of Aberdeen in Schottland der Zeitung »The Guardian«.
Frauen sterben nach Herzinfarkt häufiger als Männer
Ein Team um Dr. Mariana Martinho von der Klinik Garcia de Orta in Almada, Portugal, bestätigt mit einer aktuellen Arbeit frühere Untersuchungen, wonach Frauen nach einem Herzinfarkt eine schlechtere Prognose haben als Männer.
Die Forschenden schlossen in ihre retrospektive Beobachtungsstudie Patientinnen und Patienten ein, die zwischen 2010 und 2015 einen speziellen Infarkt (ST-Hebungsinfarkt, STEMI) erlitten hatten und innerhalb von 48 Stunden mittels perkutaner koronarer Intervention (PCI) behandelt worden waren. Insgesamt nahmen an der Studie 884 Personen teil, die im Durchschnitt 62 Jahre alt waren. 27 Prozent der Probanden waren Frauen. Diese waren im Mittel älter als die männlichen Patienten (67 gegenüber 60 Jahre), hatten seltener Koronarerkrankungen und rauchten seltener. Der Zeitraum zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und dem Beginn der Therapie unterschied sich zwischen den Geschlechtern nicht. Allerdings gab es bei jüngeren Frauen (55 Jahre und darunter) eine deutliche Verzögerung des Behandlungsbeginns nach Ankunft im Krankenhaus im Vergleich zu männlichen Patienten dieser Altersgruppe (95 gegenüber 80 Minuten).
Die Forschenden schauten sich zu zwei Zeitpunkten nach dem Myokardinfarkt das Sterberisiko an: Nach 30 Tagen waren 11,8 Prozent der Frauen und 4,6 Prozent der Männer gestorben. Das Sterberisiko war somit bei den Frauen um den Faktor 2,76 höher als bei den Männern. Nach fünf Jahren waren 32,1 Prozent der Frauen und 16,9 Prozent der Männer nicht mehr am Leben (Faktor 2,33). Die Daten wurden gerade auf dem Kongress Heart Failure 2023 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellt.
»Frauen hatten sowohl kurz- als auch langfristig ein zwei- bis dreifach höheres Risiko für eine schlechte Prognose als Männer, obwohl Vorerkrankungen mit einbezogen wurden und Frauen im gleichen Zeitrahmen behandelt wurden wie Männer«, fasst Martinho die Ergebnisse in einer Mitteilung der ESC zusammen. Frauen, die einen Herzinfarkt überstanden haben, bräuchten ein regelmäßiges Monitoring mit strikter Kontrolle des Blutdrucks, der Cholesterolwerte und des Blutzuckers sowie eine Überweisung zu einer Rehabilitationsmaßnahme.
Die Gründe für die Unterschiede wurden in der Studie zwar nicht untersucht; es kann aber gemutmaßt werden, dass genetische Faktoren und ungewöhnliche Herzinfarktsymptome bei Frauen eine Rolle spielen. Hier sei noch mehr Forschung nötig, um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern besser zu verstehen und die Prognosen von Frauen zu verbessern, so die Forscherin.
Adipositas
GLP-1-Rezeptor-Agonisten sind besonders erfolgversprechende Wirkstoffe zur Behandlung von Adipositas. Ein neues Typ-2-Diabetes-Medikament namens Tirzepatid übertraf laut aktuellen Erkenntnissen alle anderen Vergleichsmedikamente hinsichtlich der Gewichtsabnahme.
Adipositas ist eine vielfältige Stoffwechselerkrankung, die sich schädlich auf die Gesundheit auswirken kann. Für die Behandlung von Adipositas gibt es eine Anzahl von Ansätzen, unter anderem Änderungen des Lebensstils, die medikamentöse Behandlung mit Appetitzüglern sowie eine Adipositas-OP für stark adipöse Personen.
Vergleich unterschiedlicher Diabetesmedikamente
Internationale Wissenschaftler haben eine umfassende Analyse von Studien zum Thema Gewichtsabnahme mithilfe von Typ-2-Diabetes-Medikamenten durchgeführt. Studien konnten zeigen, dass einige Diabetesmedikamente zur Gewichtsabnahme beitragen können, während andere entweder eine Gewichtszunahme oder neutrale Ergebnisse bewirkten.
- Dipeptidylpeptidase-4-Hemmer: neutrale bis leichte Wirkung auf die Gewichtsabnahme
- Acarbose: leichte Gewichtsabnahme
- Metformin und SGLT-2-Inhibitoren: moderate Gewichtsabnahme
- GLP-1-Rezeptor-Agonisten: erheblicher Einfluss auf die Gewichtsabnahme
- Tirzepatide: stärkster Effekt auf die Gewichtsabnahme
Neues Diabetesmedikament zeigte stärksten Effekt
In der Zusammenfassung lässt sich sagen, dass einige der GLP-1-Agonisten wie z. B. Liraglutid und Semaglutid besonders erfolgversprechend für die Behandlung der Adipositas sind. Das neueste Typ-2-Diabetes-Medikament Tirzepatid übertraf alle anderen Vergleichsmedikamente, einschließlich Semaglutid, hinsichtlich der Gewichtsabnahme.
Hinweis: Diabetesmedikamente sind verschreibungspflichtig und sollten nicht ohne ärztliche Aufsicht eingenommen werden.
Schwangerschaftsdiabetes
Schwangerschaftsdiabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung während der Schwangerschaft. Bei den werdenden Müttern kommt es zu vorübergehend erhöhten Blutzuckerwerten. Doch nach der Entbindung vervielfacht der sogenannte Gestationsdiabetes (GDM) die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter später einen dauerhaften Typ-2-Diabetes entwickelt. Ebenso ist ihr Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich erhöht. Daher ist eine strukturierte GDM-Nachsorge zentral, sagt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG). Dennoch nehmen derzeit über 60 Prozent der Betroffenen dieses Angebot nicht wahr.
Im Jahr 2020 kamen in Deutschland 759.827 Kinder zur Welt. Etwa 56.200 Frauen entwickelten während der Schwangerschaft einen GDM. Knapp 8.000 (1,3 Prozent) der Mütter lebten bereits vor der Schwangerschaft mit einem Diabetes Typ 2. Insgesamt seien gut 9,5 Prozent der Schwangerschaften von Störungen des Blutzuckerstoffwechsels betroffen, so die „Bundesauswertung Perinatalmedizin: Geburtshilfe" des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) (1). „Wir verzeichnen leider eine steigende Tendenz bei den Zahlen", sagt Privatdozentin Dr. med. Katharina Laubner von der Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Freiburg. „Schwangerschaft ist eine Art Stresstest für den Organismus", so Laubner.
Eine Erkrankung, die man nicht spürt
So verschlechtert sich die Glukoseverwertung bei Schwangeren mit GDM durch eine Kombination komplexer Stoffwechselvorgänge. In der Folge steigt ihr Blutzuckerspiegel. „Die Patientinnen spüren zunächst nichts davon", berichtet die Endokrinologin und Diabetologin. Frauen mit höherem Lebensalter und Körpergewicht haben ein hohes Risiko für die Entwicklung eines GDM, ergänzt die Expertin.
Der zu hohe Blutzuckerspiegel kann das Ungeborene „mästen"
Obwohl der Blutzuckerspiegel nur Tage bis Wochen erhöht sein kann, ist diese Störung alles andere als harmlos. Laubner erklärt: „Da der Blutzuckerspiegel von Mutter und Kind über die Plazenta verbunden ist, wirkt sich zu viel Zucker im Blut der Mutter auch auf das Ungeborene aus. Mit ernsten Folgen: So kann es zu groß und zu schwer für eine normale Entbindung werden. Auch drohen schwerwiegende Entwicklungsstörungen und Stoffwechselkomplikationen wie Unterzuckerung des Neugeborenen nach Geburt". Später hat das Kind ein erhöhtes Risiko für Stoffwechselstörungen wie Adipositas
Schwangerschaftsdiabetes (GDM) erhöht das Risiko für Folgeerkrankungen
Bei der Mutter gilt der GDM wegen des hohen Risikos für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes nach der Geburt als Prädiabetes. Doch nicht nur das: Frauen mit GDM wiesen in einer Studie mit einer Beobachtungsdauer von durchschnittlich 7,7 Jahren ein fast 10-fach erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes auf (2). Darüber hinaus treten Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall innerhalb von 10 bis 22 Jahren nach der Entbindung doppelt so häufig auf im Vergleich zu Frauen mit normalem Blutzuckerspiegel in der Schwangerschaft, und zwar unabhängig davon, ob sie zwischenzeitlichen an Typ-2-Diabetes erkrankt sind (3, 4).
Alle Frauen mit GDM sollten zur Nachsorge gehen
Frauen mit GDM benötigen deshalb eine strukturierte Nachsorge mit regelmäßigen Screeningterminen hinsichtlich Typ-2-Diabetes, aber auch auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren, gleich, ob zwischenzeitlich ein Typ-2-Diabetes vorliege oder nicht, so Laubner. Es gehe dabei auch darum, frühzeitig Diabetes-Vorstufen zu finden, Patientinnen vorbeugende Maßnahmen anzubieten und einen bereits ausgebrochenen Typ-2-Diabetes schnell zu behandeln. Zahlen aus Deutschland aus dem GestDiab-Register zeigen jedoch, dass nur 38,2 Prozent der Frauen mit GDM ein postpartales Screening wahrnehmen, der Großteil über 60 Prozent nicht (5).
Mit gesundem Lebensstil lebt man erheblich länger
Eine Studie hat bestätigt, daß 40-jährige Männer bei einem gesunden Lebensstil im Durchschnitt 23,7 Jahre länger leben können als mit einem sehr schädlichen. Bei Frauen beträgt dieser Unterschied 22,6 Jahre.
Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse einer Langzeituntersuchung. Ehemalige Angehörige des amerikanischen Militärs präsentierten auf der internationalen Konferenz «Nutrition 2023» in Boston dieses Ergebnis. Eine Grüppe um Xuan-Mai Nguyen von der University of Illinois hatte Daten von mehr als 700.000 US-Veteranen im Alter von 40 bis 99 Jahren analysiert. Als gesunden Lebensstil definierte es acht Faktoren:
- körperlich aktiv sein
- nicht rauchen
- gut mit Stress umgehen können
- eine gute Ernährung
- nicht zuviel Alkohol trinken
- gut und regelmäßig schlafen
- positive soziale Beziehungen pflegen
- nicht von Opioid-Schmerzmitteln abhängig sein.
Als größte Risikofaktoren stellten sich eine geringe körperliche Aktivität, die Abhängigkeit von Opioid-Schmerzmitteln und Rauchen heraus. Diese Faktoren waren mit einem erhöhten Sterberisiko von jeweils um 30 bis 45 Prozent während des Studienzeitraums verbunden. Bei schlechtem Umgang mit Stress, hohem Alkoholkonsum, ungesunder Ernährung und schlechter Schlafhygiene war das Sterberisiko um jeweils rund 20 Prozent erhöht, beim Mangel an guten sozialen Kontakten um 5 Prozent.
Wechsel zu gesundem Lebenswandel lohnt sich auch im höheren Alter
Die Mediziner stellten fest, dass ein Wechsel zu einem gesunden Lebensstil auch im gesetzten Alter noch die Lebenserwartung erhöht. «Je früher, desto besser, aber selbst, wenn Sie mit 40, 50 oder 60 nur eine kleine Änderung vornehmen, ist es immer noch von Vorteil», betont Nguyen.
Quelle: https://www.pharmazeutische-zeitung.de
|